13.
Wehrmedizinhistorisches Symposium
der Gesellschaft für Geschichte der Wehrmedizin e. V.
|
Am 24.11.2022 fand die 13. Auflage des mittlerweile
traditionellen wehrmedizinhistorischen Symposiums der Gesellschaft für
Geschichte der Wehrmedizin (GGWM) in der Münchner
Ernst-von-Bergmann-Kaserne statt.
Nach Grußworten von Generalarzt Dr. Dirk-Friedrich Klagges, der den
Kommandeur der Sanitätsakademie der Bundeswehr (SanAkBw) vertrat, und
des stellvertretenden Vorsitzenden der GGWM, Oberfeldarzt Dr. Dr. André
Müllerschön (Sanitätsversorgungszentrum Neubiberg), führte Oberstarzt
Prof. Dr. Ralf Vollmuth (Zentrum für Militärgeschichte und
Sozialwissenschaften der Bundeswehr – ZMSBw) in das Thema der in
Kooperation mit der SanAkBw und dem ZMSBw durchgeführten Veranstaltung
ein.
Als erster Referent des Symposiums zeichnete Oberstleutnant Andreas
Biebricher M.A. (Kommando Sanitätsdienst der Bundewehr) in seinem
Vortrag „Johann Friedrich Goercke und die Gründung der Pépinière“
zunächst den Lebensweg des 1822 verstorbenen großen deutschen
Militärchirurgen nach, bevor er dessen wichtige Rolle bei der Gründung
und Etablierung der Pépinière darstellte. Goercke, der aufgrund
familiärer Verbindungen bereits früh Kontakt zum Militärsanitätsdienst
hatte (zwei seiner Onkel waren als Regimentschirurgen tätig), sammelte
in mehreren Feldzügen umfangreiche Erfahrungen, die er zur Reform des
preußischen Sanitätswesens nutzte. Beispielsweise setzte er mobile
Feldlazarette ein, um so die Verwundeten auf den Schlachtfeldern
schneller zu versorgen. Mit Gründung der Pépinière als einer speziellen
militärmedizinischen Ausbildungseinrichtung gelang es Goercke, sowohl
die praktische als auch die fachlich-wissenschaftliche Ausbildung der
angehenden Militärärzte nachhaltig zu verbessern.
Oberstarzt Prof. Dr. Vollmuth verdeutlichte in seinem Beitrag „Das
Josephinum und die militärärztliche Ausbildung in Österreich-Ungarn im
ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert“, welchen Einflüssen die
Ausbildung der österreichisch-ungarischen Militärärzte unterworfen war
und welche Rolle dabei Gerard van Swieten (der damalige Leibarzt der
österreichischen Kaiserin) und Giovanni Alessandro Brambilla, der die
Leitung des österreichischen Militärsanitätswesens ab 1779 innehatte,
spielten. Das Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum, so der offizielle
Name, wurde fast zehn Jahre vor der preußischen Pépinière gegründet und
zählt somit zu den ältesten und bedeutendsten militärärztlichen Aus- und
Fortbildungsstätten in Europa, obgleich es in seiner wechselvollen
Geschichte mehrfach geschlossen und wieder eröffnet worden war. Wie
Goercke einige Jahre später, plädierte bereits Brambilla für eine
medizinisch-chirurgische Ausbildung und die Überwindung der seit
Jahrhunderten getrennten Ausbildung der praktischen Chirurgen und der
universitären Mediziner. Gleichwohl stand für ihn die Chirurgie in ihrer
Bedeutung deutlich über der Inneren Medizin.
In Vertretung für den kurzfristig verhinderten Vorsitzenden der GGWM,
Generalarzt a. D. Prof. Dr. Dr. Erhard Grunwald, verlas Oberfeldarzt Dr.
Dr. Müllerschön dessen Manuskript mit dem Titel „Die militärärztliche
Ausbildung in Preußen und Deutschland in den Jahren 1895 bis 1945“. Der
Vortrag schloss direkt an die Ausführungen von Oberstleutnant Biebricher
an. Im ersten Teil standen vor allem die Zugangsvoraussetzungen und
Rahmenbedingungen der 1920 aufgelösten Kaiser-Wilhelms-Akademie im
Vordergrund. Anschließend wurden die Herausforderungen des
Sanitätsdienstes im Zuge der Aufstellung und des Aufwuchses der
Wehrmacht analysiert sowie der Studienalltag an der Militärärztlichen
Akademie beleuchtet.
Oberfeldarzt Dr. Dr. Müllerschön ging in seinem Referat „,Der
Sozialismus ist der beste, ist der einzige Arzt.‘ Die
Militärmedizinische Sektion und die Militärmedizinische Akademie als
Hauptträger der Aus- und Weiterbildung von Militärärzten in der DDR“
zunächst auf die politischen Entwicklungen bis zur Gründung der
Militärmedizinischen Sektion sowie zu deren Bedeutungsverlust durch die
Gründung der Militärmedizinischen Akademie in den 1980er Jahren ein,
bevor er kurz die Beteiligung der Akademie an der Dopingforschung in der
DDR anriss.
Zum Abschluss der Veranstaltung trug Flottenarzt a. D. Dr. Volker
Hartmann (Trier) zum Thema „,Scientiae, Patriae, Humanitati‘ Die
Sanitätsakademie im Wechsel der Zeit“ vor. Auf Grundlage der Chronik der
Akademie stellte er einige Meilensteine der Geschichte dieser für den
Sanitätsdienst zentralen Ausbildungseinrichtung vor. Neben der
konstituierenden Sitzung des Wehrmedizinischen Beirates zählten
sicherlich die teilweise in der Hochzeit des Kalten Krieges erfolgten
Besuche hochrangiger russischer und chinesischer Delegation zu den
besonderen Ereignissen.
Alle Referate des Symposiums werden als Tagungsband der GGWM
voraussichtlich Mitte des Jahres 2023 veröffentlicht.
Oberfeldarzt Dr. André Müllerschön

Referenten des 13. Wehrmedizinhistorischen Symposiums, Bildquelle: Peter
Rechenberg
|
| |
|
„Sanitätswagen des Feldlazaretts“ wird an
das Militärhistorische Museum in Dresden ausgeliehen
Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr bereitet
derzeit die Sonderausstellung „Krieg, Sieg und Nation“ vor,
in deren Zentrum die Kriege 1864, 1866 und 1870/71 stehen.
Die Sonderausstellung folgt einem multiperspektivischen
Ansatz, der Militärgeschichte mit kulturhistorischen und
politikgeschichtlichen Fragestellungen verbindet. In diesem
Rahmen hat das Museum die Militärhistorische Lehrsammlung
der SanAkBw gebeten, eines unserer besonderen Exponate, den
sogenannten Feld-Apothekenwagen, für das Jahr 2020
auszuleihen. Die ehemals pferdegespannte Karosse stand
früher in der Vorhalle des Akademiestabsgebäudes und ist
seit April 2013 in der Halle 10, der permanenten
Ausstellung, zugänglich. Bei dem Fahrzeug handeltes sich um
einen „Sanitätswagen des Feldlazaretts (Modell 1867)“ und
wurde in diesem Jahr in der preußischen Armee eingeführt.
Der auch in den Kriegen 1870/71 und 1914/18 eingesetzte
Sanitätswagen wurde im Juli 1970 durch den damaligen
Inspekteur des Sanitätsdienstes der britischen Armee an den
deutschen Sanitätsdienst übergeben und ist seither eines der
bedeutendsten Exponate unserer Lehrsammlung. Die
Kommandeurin der SanAkBw hat der Leihgabe zugestimmt. Als
„Ersatz“ werden wir ein Amphibienfahrzeug vom Typ LuAZ-967
der ehemaligen NVA erhalten. Es diente als sogenanntes
„Geschädigtentransportfahrzeug“. Außerdem bekommen wir einen
KRAKA der Bundeswehr vom Militärhistorischen Museum als
Leihgabe.
Flottenarzt Dr. Volker Hartmann |
 |
|
| |
|
Die „Westersteder Rot-Kreuz-Fahne“ in der
Militärhistorischen Lehrsammlung der SanAkBw
Die Flagge hing lange in den Bundeswehrkrankenhäusern Bad
Zwischenahn und Westerstede an prominenter Stelle. Im
Oktober 2017 wurde sie von Oberfeldarzt a. D. Klaus Pellnitz
aus Bad Zwischenahn der Militärhistorischen Lehrsammlung
übertragen. Das bedeutende Exponat stammt aus dem Besitz
seines Großvaters, eines hohen Sanitätsoffiziers der
Wehrmacht. Sie wehte im Mai 1945 in der Schlacht um Berlin
auf einem Hauptverbandplatz in der Nähe des Reichstages und
konnte sichergestellt werden.
Die 190 x 180 cm große Rot-Kreuz-Flagge bedarf nun einer
fachgerechten Restaurierung. Mit finanzieller Hilfe der GGWM
wurde eine erste Begutachtung durch eine
Fahnenrestaurateurin vorgenommen. Ziel ist es, die
notwendigen Eingriffe an der Fahne möglichst gering zu
halten, sie dann auf einer gepolsterten, schräggestellten
Platte zu montieren und in einer Vitrine zu präsentieren.
Flottenarzt Dr. Volker Hartmann |
 |
|
| |
|
Ölgemälde „Hofapotheker Caspar Neumann“
wird an das Humboldt-Forum Berlin ausgeliehen
Verschiedene Gemälde aus den Sammlungen der ehemaligen
Militärärztlichen Akademie Berlin befinden sich heute im
Bestand der Sanitätsakademie der Bundeswehr und sind damit
Eigentum im Sammlungsgut der Bundeswehr. Nun hat uns eine
interessante Anfrage aus Berlin erreicht, in der um Leihgabe
eines dieser Gemälde für die Ausstellungseröffnung des
Humboldt-Forums im wieder errichteten Stadtschloss in der
Hauptstadt gebeten wird. Die Humboldt-Universität zu Berlin
möchte das Ölgemälde „Hofapotheker Caspar Neumann“ für die
Eröffnungsveranstaltung des Humboldt-Forums im Jahre 2020
ausleihen. Das dem Maler Joachim Martin Falbe zugeschriebene
Porträt des Hofapothekers Caspar Neumann (1683–1737) ist für
die Geschichte des neuerrichteten Stadtschlosses von großer
Bedeutung. Neumann war bis zu seinem Tod Hofapotheker des
preußischen Königs. Er arbeitete und lebte im
Apothekerflügel des Stadtschlosses, war der erste
pharmazeutische Hochschullehrer und Professor der
praktischen Chemie am Collegium medico-chirurgicum in Berlin
und wurde vom Souverän mit der Aufsicht über die Apotheken
im Königreich Preußen betraut. Caspar Neumann hat somit
höchste Bedeutung für die Entwicklung der wissenschaftlichen
Pharmazie. Die Kommandeurin der SanAkBw, Frau
Generalstabsarzt Dr. Gesine Krüger, hat der Ausleihe
zugestimmt, denn sie trägt zu einer positiven Darstellung
der Akademie und der Bundeswehr bei dem größten
Kulturprojekt Deutschlands bei. Das Gemälde, welches bisher
an prominenter Stelle im Garchinger Zentralinstitut des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr ausgestellt war, ist
inzwischen wieder in der SanAkBw und wird für die Ausleihe
vorbereitet.
Flottenarzt Dr. Volker Hartmann |
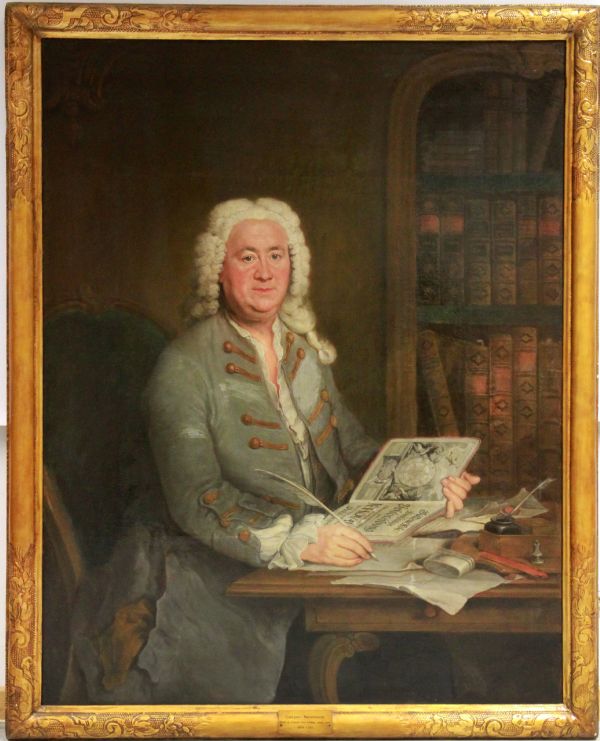 |
|
|
